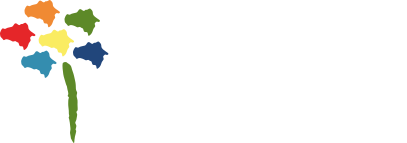Nicht nur durch seine unverwechselbare Landschaft und Lebensweise ist der Lungau einzigartig. Auch ein charakteristischer Baustil, besondere Arbeitsweisen und die Lebensart mit altem Brauchtum und Traditionen konnten sich in diesem Salzburger Gau ganz urtümlich erhalten. Egal ob es bäuerliche Gerätschaften, Hofformen, die Dachlandschaft, Materialien, Werkzeuge oder Arbeitsmethoden betrifft, man erkennt besondere Ausprägungen und somit gravierende Unterschiede zu den nördlichen Landesteilen. Der pensionierte Oberforstinspektor und Museumsgründer Hofrat Prof. DI Arno Watteck erklärt, dass der Tauernpass als historische Kultur-Grenze gilt, die Europa gewissermaßen scheidet.
Von der Geschichte her ist der Lungau eher slawisch geprägt, die anderen Gaue Salzburgs nördlich vom Tauern eher bajuwarisch. An den verschiedenen Ausformungen vieler Arbeitsgeräte kann man diese Grenze am besten wahrnehmen.
Hofrat Prof. DI Arno Watteck
Oberforstinspektor und Museumsgründer
Dengelstock & Sensen
Als Beispiel führt er den Dengelstock an, der südlich vom Tauern anders ausgeformt war als im Norden. So hatte der Lungauer Dengelstock (Dengelamboss) eine Schlag-Kante, auf die die Schneide der Sense (Schmatzn) aufgelegt wurde und worauf dann mit einem breiten Hammer geschlagen wurde. Diese Arbeitsweise gelang recht einfach, war kraft- und zeitsparend. In der nördlichen Ausprägung wurde die Sense beim Dengeln auf eine Schlag-Fläche aufgelegt und man musste mit der Schlagkante des Dengelhammers genau auf die Schneide der Sense treffen, was schwieriger zu gelingen schien. Auch beim Sensenstiel, dem sogenannten „Worb“, gab es Unterschiede: Im bayrischen Kulturkreis war der Mittelgriff so angebracht, dass er nach rechts zeigte und stark nach oben verkröpft war. Dadurch konnte der Mäher fast aufrecht stehen, musste allerdings die Sense mit Kraft schieben. Im Lungau war der Mittelgriff meist nach links gekrümmt und kaum nach oben verkröpft, sodass die Sense kraftsparend, jedoch in gebückter Haltung gezogen werden konnte.
Es scheint, im Lungau waren praktischer Nutzen und die einfache Handhabung der Werkzeuge und Geräte schon immer von hohem Stellenwert. Diese Unterschiede und Besonderheiten der Dinge sind für den Heimatforscher so interessant, da ihre geschichtliche Bedeutung und Entwicklung die alltäglichen Lebens- und Arbeitsweisen, welche die Menschen in einer Region prägen, besser verständlich machen.

Die zwei verschiedenen Dengelambosse: links mit Schlagfläche, wie im Norden üblich, rechts mit Schlagkante, wie im Lungau üblich. (Ausgestellt im Lungauer Heimatmuseum.)
Hofrat DI Arno Watteck
Geboren wurde Arno Watteck im Jahr 1926 als Sohn des Salzburger Beamten Dr. Wilfried Watteck und der Schriftstellerin und Heimatforscherin Nora Watteck. Arno Watteck maturierte 1946 am Akademischen Gymnasium Salzburg und absolvierte ein Studium der Forstwirtschaft an der (damaligen) Hochschule für Bodenkultur in Wien. In der Studienzeit arbeitete er sogar in einer Kunsttischlerei. Da diese keine einzige Maschine hatte, mussten alle Arbeiten mit der Hand erledigt werden – vorrangig waren dies restaurierende Arbeiten im Zusammenhang mit dem Antiquitätenhandel.
DI Arno Watteck kam Ende der 1950er-Jahre als Regierungsoberforstrat in den Lungau und widmete sich neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit auch vermehrt Aufgaben rund um Volkskunde, Heimatforschung und Denkmalschutz. Im Jahr 1960 gründete er den Museumsverein Tamsweg und übernahm die Leitung des neu gegründeten Bezirksmuseums (das heutige Heimatmuseum). Er war außerdem Mitinitiator des Lungauer Landschaftsmuseums (in der Burg Mauterndorf) und leistete wichtige Beiträge zur Gründung des Hochofenmuseums in Bundschuh. Nicht nur das, er rettete die Anlage sogar vor der Demolierung bzw. Abtragung, indem er das Denkmalamt überzeugte, dass der Hochofen Bundschuh eines der ersten Zeugnisse für die Industrialisierung im Lungau sei.
Der gebürtige Salzburger richtete damals vor allem die Museen ein und hat dafür fleißig gesammelt. Durch seine Arbeit als Forstinspektor kam DI Watteck im Lungau auch zu vielen Bauernhöfen und verstand gleich, dass die alten Einrichtungsgegenstände oder Gerätschaften als volkskulturelle Schätze bewahrt werden müssen. So sicherte er manch wertvolles Stück vor dem Abtransport fahrender Händler.
Restaurierung
Zu seinem großen Leidwesen seien viele Möbelstücke und Geräte in den 50er- und 60er-Jahren der Modernisierung zum Opfer gefallen. Vieles an Hausrat ist ausrangiert oder aus praktischem Nutzen weiß übermalt oder lackiert worden. Manche Stücke, darunter vor allem Kästen, Truhen und Türen, konnte er allerdings erwerben und „fit“ fürs Museum machen, indem er sie detailgetreu restaurierte.
Wie der Kenner erklärt, gab es im Lungau vor 1700 hauptsächlich gezimmerte Blankholzmöbel ohne Farbe. Manche Stücke wurden mit Ochsenblut gestrichen, um ihnen etwas Farbe zu verleihen, vor allem aber, um sie vor Schädlingen zu schützen. (Dabei wurde Ochsenblut mit Galle versetzt, um es streichbar zu machen und zum Auftragen mit Wasser verdünnt.) Als Versiegelung wurde verdünntes Leinöl oder Leinöl-Firnis eingesetzt, was die Möbel wasserabweisend, witterungs- und schmutzbeständiger machte. Leinöl-Firnis ist im Grunde gekochtes Leinöl. Leinöl wurde aus Leinsamen, den reifen Samen des Flachs, welche bei der Flachsverarbeitung in den Lungauer Brechelgruben separiert wurden, in einer Leinölstampfe gepresst.
Arno Watteck benutzte bei seinen Restaurierungen vorzugsweise ein besonderes Wachs-Firnis-Gemisch, welches das Holz nicht nur schützt und nährt, sondern die Malerei gut versiegelt und dem Möbel auch einen seidig matten Glanz verleiht. Dazu mischt der Hobbytischler einen Teil Leinölfirnis mit zwei Teilen Terpentin oder Ölfarbenverdünnung und gibt noch einen Teil (durch Erhitzen) flüssig gemachtes Wachs (Bienen- oder Kerzenwachs) dazu.

Typische Leinölstampfe, wie sie früher verwendet wurde. (Ausgestellt im Lungauer Heimatmuseum in Tamsweg).

Originale Tür im Rokoko-Stil, 18. Jhd.

Nachgebaute Tür aus Altholz, mit Ochsenblut eingelassen, mit Leinöl-Wachs-Firnis versiegelt und mit alten Scharnieren aus Zinn ergänzt.
Weiters erklärt der Museumsgründer, dass man erst ab dem 18. Jahrhundert Bauernmöbel farbig bemalt hat. Nach den Unruhen im 17. Jahrhundert – der Dreißigjährige Krieg, die Pest und Türkenbelagerung bzw. Türkenkriege – ging es wirtschaftlich wieder etwas aufwärts. Dann begann man auch im bäuerlichen Bereich damit, so manch Hausrat mit Farben und Verzierungen zu verschönern. Schnitzereien, Verschnörkelungen und Farbakzente gaben den Truhen und Kästen eine besondere Pracht.
Beliebte Muster waren einerseits geometrische Figuren, andererseits herbale Motive in Form von Ranken oder Blüten, daneben aber auch fantasievolle Arabesken. Am Anfang waren die Farben für die Verzierungen schwarz, dann oxydrot und oxydocker, erst später grün oder blau. Ruß- oder Kohlefarben mit Kasein-Bindung konnte man leicht herstellen. Sogar heute verwenden manche Künstler und Restauratoren noch eine Mischung aus Topfen und zirka 10% mindestens drei Jahre alten, gelöschten Kalk, mit etwas Wasser verrührt, für spezielle Restaurierungen. Maler stellten früher einen auf diese Art gemischten Topfen-Kalk-Leim als Farbfestigungsmittel her. Selbst Tischler griffen zu diesem Kasein-Leim bei Arbeitsstücken, die hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt waren und bei denen der Knochenleim nicht mehr standhielt.


Restaurierter Kasten mit farbigen Mustern und Arabesken.

Sorgsam restaurierte Truhe. Die Truhe stammt vermutlich aus dem Schaffen der Tischlerfamilie Seitlinger, aus der auch der Altar-Tischler Jakob Seitlinger entstammt.
Gutes Handwerk lebt vom Verstehen der Zusammenhänge und nicht nur vom Aneignen des Wissens.
Bei seinen Restaurierungen bemühte er sich auch um den Einsatz natürlicher Materialien und Arbeitsweisen. Sein Kredo war stets: Im Einklang mit der Natur sein, die Natur beobachten und verstehen, denn man kann so viel aus ihr lernen. Außerdem unterhielt er sich gerne mit pensionierten Meistern und Handwerkern. Diese befragte er über die Künste und Bräuche ihrer Zunft, wollte wissen und verstehen, wie die Arbeiten früher verrichtet wurden. Seine Vermutung damals: Was vor langer Zeit gut war und wirkte, könnte ja heute genauso gut eingesetzt werden. So erfuhr der Naturliebhaber unter anderem, dass Werkzeug-Griffe oft aus Holunderholz hergestellt wurden, da man davon keine Schwielen und Blasen bekam. Rechenzähne wurden aus dem Holz der Berberitze ergänzt, weil es sehr hart, zäh und elastisch ist und so der Belastung besser standhält – im Gegenteil zu anderem Holz, welches spröde ist.
Arno Watteck war jahrzehntelang Mitglied der Ortsbildschutzkommission für den Lungau und wurde für einige Perioden zum „Ehrenkonservator“ des Bundesdenkmalamtes ernannt. Für den heute 94-Jährigen, der in Haslach, St. Andrä, lebt, war und ist der Lungau einzigartig, vor allem in seiner geschlossenen Hauslandschaft, den Hofstrukturen und Ausformungen, der gewissen Lungauer Eigenart. Ein besonderes Anliegen waren dem Denkmalschutzbeauftragten demnach auch die Erhaltung und Restaurierung der historischen Troadkästen und Wetterkreuze, wobei er sich stets um eine möglichst originale Ausführung und Darstellung bemühte.

Hölzerner Troadkasten, wie er im Lungau im 17. Jahrhundert typisch war. Gezimmert in Holzblockbauweise mit Schwalbenschwanzverzinkung. Das Untergeschoß wird vom Obergeschoß optisch durch ein leichtes Vorkragen, die Mauswehr, getrennt. Dieses Exemplar wäre 1975 beinahe Hof- und Straßenbauarbeiten zum Opfer gefallen. Nach fachgerechtem Abtragen und Wiederaufbauen steht der imposante Kasten seither am Grundstück von DI Arno Watteck in Haslach.
Im Lungau sind vor allem die gemauerten Getreidekästen ein Begriff und unter Wattecks Aufsicht wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren weit über 30 Stück renoviert. Übermalte Motive wurden dabei sorgsam freigelegt und verwitterte Ornamente mühselig rekonstruiert. Die Herausforderung war auch die damalige Bauweise: Früher hatte man keinen Zement oder keine Kunststoff-Zusätze für die Aushärtung der Mauerwerke zur Verfügung. Trotzdem konnte man mindestens genauso beeindruckende Bauwerke errichten, die den Einflüssen der Natur Stand hielten und weder gesundheitsbedenklich noch umweltschädlich waren. Dazu wurde vor allem mit Kalkputz oder Kalkmörtel gearbeitet. Dieser wurde aus Sand, 10 bis 20 Prozent Kalk sowie Wasser nach Bedarf gemischt. Bevor es Beton und Fertigzement gab, konnte man den Kalkmörtel noch härter machen, indem man einen kleinen Teil ungelöschten Kalk dazu gab, und wenn man diesen gleich verarbeitete wurde er so steif, dass er allem standhielt.
Eine weitere gute Methode um den Mörtel fester und vor allem wasserbeständig zu machen, waren auch die bereits erwähnten Kasein-Bindungen. Dazu wurde dem Mörtel eine kleine Menge (in etwa 5 Prozent) Topfen, Eier oder Blut (meistens Rinderblut, das sowieso bei den Schlachtungen anfiel) beigemengt. Dieser Kalkmörtel neigte dann weniger zu Riss- und Spaltenbildung. Heute könnte man als Mischverhältnis wie folgt angeben: eine Packung (Mager-)Topfen, ein halber Liter Rinderblut oder zwei Eier pro Mischmaschine.
DI Arno Watteck hat viel und mit gutem Ergebnis mit diesen Kasein-Bindungen experimentiert, konnte sie aber bei den Restaurierungen nicht immer offiziell einsetzen, da diese Methoden Amtswegen nicht angemessen waren und andere Materialien den Vorzug erhielten. Doch er ist überzeugt, dass die modernen Verfahren nicht unbedingt besser sind. Für ihn ist das Verstehen von Zusammenhängen und die positive Erfahrung wichtiger als wissenschaftliche Erkenntnisse, die morgen schon widerlegt werden können. Außergewöhnliches kann nur durch besondere Behandlung erhalten und geschützt werden und so auch seine Einzigartigkeit bewahrt werden!
Artikel: Hemma Santner-Moser
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Mit der Veränderung von Wirtschaft, Arbeitswelten und Technologien geht „altes Wissen“ bzw. Erfahrungswissen verloren. Die ältere Generation verfügt noch über dieses Wissen, das in Verbindung mit neuen Technologien und Designs aber durchaus Potential für künftige Entwicklungen bietet. Für den Biosphärenpark Lungau als Modellregion für nachhaltige Entwicklung ist die Erhaltung, Sicherung und Dokumentation von altem regionalem Wissen eine wichtige Aufgabe, um so die nachhaltige Entwicklung der Region voranzubringen.