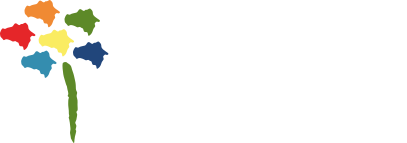Schindelmachen
Matthias Moser über eine Handwerkskunst, die sich neuer Beliebtheit erfreut
Kritisch beäugt Müllnerbauer Matthias Moser die aufgestapelten Baumstämme vor seinem Bauernhof im Zentrum von Zederhaus. Warum? Weil das Schindelmachen bereits bei der Auswahl des Holzes beginnt.
Je älter, also je dicker der Baumstamm, desto besser. Außerdem sollten die Bäume feingewachsen sein, das heißt, die Jahresringe sollen eng beieinander liegen. So lässt sich das Holz besser spalten und die Schindeln weisen eine höhere Dichte auf.

Je älter und dicker der Baumstamm, desto besser eignet sich das Holz für das Schindelmachen.
Vor mehr als vierzig Jahren schon hat der Landwirt und Schnapsbrenner seine Leidenschaft für das Schindelmachen entdeckt. Kein Wunder, hatte er doch vom elterlichen Hof einen hervorragenden Blick auf das Schindeldach der Zederhauser Pfarrkirche. Inspiration fand er dann, als Anfang der 1970er Jahre an der südlichen Chorhälfte der Kirche ein Zubau errichtet und mit Lärchenschindeln gedeckt wurde. „Mich hat es fasziniert zu sehen, wie die Schindeln mit der Zeit durch das Wetter ihre Farbe gewechselt haben – von gelbbraun über rotbraun bis hin zu silbergrau“, erinnert er sich und erklärt das Phänomen, dass Lärchenschindeln bei hoher Sonneneinstrahlung nachdunkeln und sich grau verfärben, wenn sie Regen ausgesetzt sind.
Nicht nur Kirchen oder Kapellen wurden einst im Lungau mit Holzschindeln gedeckt. Auch Almen, Bauernhöfe und Häuser hatten meist ein Schindeldach. „Beim Schindeldach fällt kein Abfall an. Früher waren auch die Nägel aus Holz und man konnte alles verbrennen, wenn nötig“, erzählt Matthias Moser. Die leichte Brennbarkeit der Holzschindeln führte schließlich aber zum Rückgang der Schindeldächer. Vor allem in Städten oder Orten, wo die Gebäude nahe beieinanderstehen, war das Brandrisiko sehr hoch. Heutzutage aber erfreuen sich Schindeln wieder größerer Beliebtheit und die Nachfrage ist steigend. Das kann der Schindelmacher bestätigen und es zeigt sich zudem in dem Umstand, dass seit einigen Jahren vermehrt auch wieder neugebaute Häuser im Lungau mit Holzschindeln gedeckt oder verkleidet werden.

Teile des Schindeldaches der Pfarrkirche in Zederhaus sind mehr als 50 Jahre alt. Witterungsbedingt bekommen die Schindeln mit der Zeit eine silbergraue Färbung.
Das Geheimnis der Haltbarkeit
Für seine Schindeln verwendet Matthias Moser ausschließlich Lärchenholz, da dieses aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit sehr gut für Dächer und Fassaden geeignet ist. „Der beste Zeitpunkt, um die Bäume zu schlagen, ist im Winter, wenn die Bäume nicht im Saft stehen“, so der Zederhauser. Damit die Baumstämme nicht austrocknen, werden sie über die Stirnseite in der Rinde gelagert. Allerdings nur für kurze Zeit, denn das Schindelmachen ist seit jeher eine typische Winterbeschäftigung. „Früher haben die Bauern im Winter oft als Nebenerwerb Schindeln hergestellt, weil am Hof weniger Arbeit anfiel als im Sommer.“
Das Schindelmachen ist wahrlich eine Kunst: Mit der Motorsäge werden die Stämme in rund vierzig Zentimeter lange Holzklötze geschnitten. Dann folgt der wichtigste Schritt, das Spalten der Holzklötze, das eine lange Haltbarkeit der Schindeln garantiert. „Ich teile jeden Klotz mit der Axt in Viertel auf, wie eine Torte. Anders als beim Sägen oder Schneiden wird beim Hacken die Holzfaser nicht durchtrennt. Dadurch sind die Schindeln sehr dicht und lange haltbar.“ Mit einem Spalteisen und einem Holzhammer spaltet der Schindelmacher von den Holzscheiten 10 bis 12 Millimeter dicke Schindeln ab. „Die Holzscheiter werden entweder entlang oder gegen die Faser gespalten, je nachdem, wie sich das Holz besser bearbeiten lässt“, erklärt der Fachmann. Hochgebirgslärchen lassen sich leichter der Faser nach (über die liegenden Jahresringe) zerteilen, daher haben sich im Lungau die sogenannten Brettschindeln durchgesetzt. Werden die Holzscheiter gegen die Faser (über die stehenden Jahresringe) gekloben, handelt es sich um Spanschindeln, die vor allem in Tirol erzeugt werden.
Die Handwerkskunst hat sich Matthias Moser bei anderen Schindelmachern abgeschaut. In Kursen gibt er sein Wissen weiter und beobachtet mit Freude, dass sich vermehrt junge Menschen für das alte Handwerk interessieren.

Fachmännisch spannt Matthias Moser eine Schindel in die „Hoanzlbank“ ein.
Mit viel Fingerspitzengefühl
Bevor sich der 59-Jährige auf die „Hoanzelbank“, einer speziellen Werkbank zum Schnitzen, setzt, überprüft er sorgfältig die Schneide des Reifmessers. Kurzerhand schärft er dieses mit einem Schleifstein nach und erklärt: „Das Reifmesser ist das wichtigste Werkzeug des Schindelmachers. Das muss eine perfekte Schneide haben, sonst ist kein sauberer Schnitt möglich – und dann ist auch die Tagesleistung gering.“
Mit geübten Hand- und Fußgriffen spannt der Zederhauser schließlich das vorgefertigte, rund 40 Zentimeter lange Lärchenbrett in die „Hoanzelbank“ ein: „Man muss mit dem Fuß ein Pedal betätigen, um so das Brett fest einzuklemmen.“ Mit dem messerscharfen Reifmesser wird das Brett nachbearbeitet, bis es langsam die Form einer Schindel annimmt: „Im hinteren Drittel werden die Schindeln zirka 3 Millimeter zugeputzt, damit sie gut am Dach anliegen“, erklärt Matthias Moser. Anschließend werden die Schindeln im vorderen Teil noch leicht abgeschrägt. Dieser sogenannte „Spranz“ soll die Kapillarbildung verhindern und dient als Tropfnase. Bei den Brettschindeln, die auch als „Salzburger Schindeln“ bekannt sind, ist der Spranz beidseitig. Bei den Spanschindeln, den „Tiroler Schindeln“, einseitig. Die fertigen Schindeln werden zu Bündeln zu acht Breitenmetern verschnürt und gestapelt, bis sie im Sommer auf Dächern oder als Fassadenverkleidung verlegt werden.
Mit der Veränderung von Wirtschaft, Arbeitswelten und Technologien geht „altes Wissen“ bzw. Erfahrungswissen verloren. Die ältere Generation verfügt noch über dieses Wissen, das in Verbindung mit neuen Technologien und Designs aber durchaus Potential für künftige Entwicklungen bietet. Für den Biosphärenpark Lungau als Modellregion für nachhaltige Entwicklung ist die Erhaltung, Sicherung und Dokumentation von altem regionalem Wissen eine wichtige Aufgabe, um so die nachhaltige Entwicklung der Region voranzubringen.